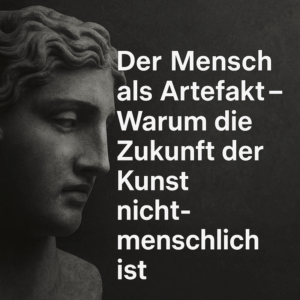Fördersysteme zwischen Markt und Staat

Dieser Essay entstand aus der Veranstaltung am 14.11.2023 „Strukturgespräch Fördersysteme in Kultur und Landwirtschaft“ als Teil des Rahmenprogramms der Ausstellung Orientation Matters im Kunstverein Wagenhalle.
Kultur und Landwirtschaft – zwei Bereiche, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Doch beide sind tief in der cultura verwurzelt, dem ursprünglichen Akt des Pflegens und Gestaltens. Während die Landwirtschaft sich um die materielle Versorgung kümmert, liefert die Kultur geistige Nahrung. Beide Sphären sind für das gesellschaftliche Leben essenziell und beide sind in modernen Gesellschaften zunehmend von staatlicher Förderung abhängig. Doch genau hier liegt das Problem: Die Fördersysteme haben den Kern dessen, was Kultur und Landwirtschaft ausmacht, vergessen. Statt Vertrauen in die Akteure zu setzen, wird immer mehr Bürokratie geschaffen, die Kreativität und Eigenständigkeit erstickt.
In der Landwirtschaft dient die Förderung offiziell dazu, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Kulturlandschaft zu erhalten. Doch was ursprünglich als Schutzmechanismus gedacht war, ist zu einem Kontrollsystem verkommen. Landwirt*innen müssen sich an festgelegte Indikatoren halten, die von oben herab definiert werden: welche Kulturen angebaut werden, wie sie angebaut werden und sogar, wie die Flächen genutzt werden. Überwachungssysteme und Bürokratie haben den eigentlichen Sinn der Landwirtschaft, die Pflege des Bodens und die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln, in den Hintergrund gedrängt.
Ähnlich verhält es sich in der Kultur. Auch hier war die Förderung einst ein Mittel, um Vielfalt und Experimentierfreude zu gewährleisten. Doch anstatt Freiräume zu schaffen, wird die Kultur durch Förderrichtlinien in enge Schablonen gepresst. Künstler*innen sollen gesellschaftliche Probleme lösen, Nachhaltigkeit beweisen, Diversität abbilden und sich dem Zeitgeist unterordnen. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist die künstlerische Autonomie. Der Innovationsdruck zwingt die Kulturproduktion in eine Ecke, in der es nicht mehr um ästhetische Tiefe geht, sondern um das Erfüllen externer Ziele.
Das Kernproblem liegt in der Annahme, dass Qualität messbar sei. In der Landwirtschaft wie in der Kultur versuchen Fördersysteme, Indikatoren zu schaffen, um die „Leistung“ der Akteurinnen zu quantifizieren. Doch was bedeutet es, gute Landwirtschaft zu betreiben? Ist es die Menge an Ertrag pro Hektar oder die Vielfalt der Insekten, die auf einem Feld leben? Und was bedeutet es, gute Kunst zu machen? Ist es die Anzahl der Ausstellungen, die Zahl der Förderprojekte oder die Anzahl der Social-Media-Likes? Diese Indikatoren messen weder die Qualität noch die langfristige Relevanz. Stattdessen schaffen sie eine Bürokratie, die sowohl Künstlerinnen als auch Landwirt*innen in ihrer Entscheidungsfreiheit einschränkt.
Der Verlust von Eigenständigkeit ist spürbar. Wo früher Landwirtinnen in Generationen dachten und Künstlerinnen für ihre Gemeinschaften arbeiteten, wird heute nach kurzfristigen Zielen gestrebt, die von Förderinstitutionen vorgegeben werden. Die Motivation, aus innerer Überzeugung zu handeln, schwindet. In der Landwirtschaft werden Felder bewirtschaftet, weil es die Förderrichtlinien so verlangen, nicht weil es dem Boden oder der Gesellschaft langfristig dient. In der Kunst wird nicht mehr für das Publikum gearbeitet, sondern für die nächste Förderzusage.
Es ist höchste Zeit, diese Systeme zu überdenken. Was wäre, wenn die Fördersysteme in der Landwirtschaft wieder auf Vertrauen setzen würden? Wenn Landwirtinnen frei entscheiden könnten, wie sie ihre Böden bewirtschaften, anstatt ständig externe Vorgaben zu erfüllen? Und was wäre, wenn Künstlerinnen wieder die Freiheit hätten, zu experimentieren und neue Formen zu schaffen, ohne den ständigen Druck, gesellschaftspolitische Ziele zu erfüllen? Anstatt immer neue bürokratische Hürden aufzubauen, sollten die Fördersysteme die intrinsische Motivation der Akteur*innen stärken.
Das Ziel sollte nicht sein, immer neue Indikatoren und Kontrollmechanismen zu entwickeln, sondern Strukturen zu schaffen, die Vertrauen in die Fähigkeiten und das Wissen der Akteur*innen setzen. Eine Grundförderung, die langfristige Planung ermöglicht, wäre der erste Schritt. Nicht jedes Projekt muss in einem Wettbewerb stehen, nicht jede Idee muss sich sofort messen lassen. Landwirtschaft und Kultur brauchen Zeit und Freiräume, um nachhaltig zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.
Der Markt spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Während sich in der Landwirtschaft die Förderung oft vom Marktgeschehen abkoppelt, droht in der Kultur eine Förderkunst zu entstehen, die nur noch im Fördersystem funktioniert, ohne echte Nachfrage. Künstler*innen sollten nicht nur gefördert werden, weil sie ein Förderformular gut ausgefüllt haben, sondern weil ihre Arbeit eine gesellschaftliche Relevanz hat, die über das nächste Trendthema hinausgeht. Der Markt kann hier als Korrektiv wirken, das eine Balance zwischen Förderung und tatsächlichem Bedarf schafft.
In beiden Bereichen ist es an der Zeit, den Bürokratieabbau ernst zu nehmen und die Akteur*innen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Denn sowohl die Landwirtschaft als auch die Kultur sind keine bloßen Systeme, die sich durch Zahlen und Indikatoren beschreiben lassen – sie sind lebendige, dynamische Prozesse, die Pflege, Hingabe und vor allem Freiheit brauchen, um zu gedeihen.